Am 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) in Kraft. Das Gesetz verpflichtet private Unternehmen dazu, ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu machen. In diesem Beitrag erfährst du, was Leichte Bilder und visuelle Kommunikation mit digitaler Barrierefreiheit zu tun haben und so dazu beitragen können, wichtige Informationen auch Menschen mit Behinderungen zugänglich zu machen. So kann man nicht nur deutlich mehr Menschen erreichen, sondern kommuniziert auch fair!
Bis heute sind es nur öffentlichen Einrichtungen, die zu digitaler Barrierefreiheit verpflichtet sind. Das Gesetz erweitert die Pflicht nun auch auf private Unternehmen und ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen. Das Gesetz ist die Umsetzung des European Accessibility Act auf nationaler Ebene. Für mehr Details zu betroffenen Produkten und Dienstleistungen kann man sich zum Beispiel bei der IHK Leipzig informieren.
Was ist das Ziel des BFSG?
Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben uneingeschränkt teilzunehmen – so ist das Ziel des BFSG definiert. Besonders Menschen mit Behinderungen, ältere Personen oder Menschen mit wenig Erfahrung mit digitalen Medien stehen bei digitalen Dingen oft vor Hürden, die ihnen den Zugang erschweren. Das Gesetz setzt hier an und fordert, dass Produkte und Dienstleistungen so gestaltet werden, dass sie für alle verständlich, leicht zugänglich und selbstständig ohne fremde Hilfe bedienbar sind.
Ein paar Beispiele für Bilder und visuelle Gestaltungselemente im digitalen Bereich
Eins der ersten Dinge, die man (unbewusst) von einer Webseite oder einer App wahrnimmt, ist das Layout. Das ist die Komposition der GESAMTEN Seite. Gestalter*innen, die Layouts machen, fragen sich also: Wie sind die Elemente auf der Seite verteilt, damit man sie gut findet? Wie soll die Lesereihenfolge sein? Auch die gesamte Strukturierung einer Webseite gehört zu Layout und beeinflusst dieses.
Ein sehr häufiges Beispiel für Bilder im digitalen Bereich sind Piktogramme. Sie erleichtern die Orientierung und Navigation auf Webseiten und in Apps – unabhängig von Sprache oder Vorwissen. Sie funktionieren ähnlich wie ein Straßenschild, um den Nutzer*innen den Weg in bestimmte Bereiche auf einer Webseite oder in einer App zu zeigen. Es gibt auch Fotos und Illustrationen, die bei der Navigation helfen. Sie sind größer und komplexer als Piktogramme. Sie können z.B. die Bereiche auf einer Webseite oder in einer App markieren, die zu einer Unterseite führen. Sie sollten deswegen das Thema der Unterseite andeuten.


Text und wie er aussieht ist ein weiterer Teil der visuellen Gestaltung. Typografie nennt man diesen Bereich aus dem Design. Gestalter*innen, die sich mit Schriftgestaltung auseinandersetzen, fragen sich zum Beispiel: Welche Schrift passt zur Leserschaft, zum Inhalt und zum Medium? Wie groß soll die Schrift sein? Wie groß ist der Abstand zwischen den Zeilen?
Wir nehmen Farben unmittelbar wahr. Farben wirken sehr schnell und haben großen Einfluss auf die Wirkung einer Webseite oder einer App. Es gibt Entscheidungen, die wir unbewusst treffen, die von Farben beeinflusst sind. Auch die Wahl von bestimmten Farben können Menschen ausschließen. Deswegen sollte man bewusst damit umgehen.
Bilder im Kopfbereich (Bannerbild) sind in der Regel relativ groß und auf einer Webseite auch eins der ersten Elemente, die ein Besucher der Webseite wahrnimmt. Das Bannerbild macht den ersten Eindruck, sollte aussagekräftig sein und das Thema interessant darstellen. Daher sollte beim Bannerbild auch auf Barrierefreiheit geachtet werden.

Bilder, die Textinhalte visualisieren, lockern Webseiten und Apps auf und machen sie anschaulicher. Webseiten mit reinen Textinhalten sind für viele Menschen schwerer zugänglich. Es ist daher wichtig, dass diese Bilder gibt. Eine Besonderheit dabei sind Leichte Bilder für Leichte Sprache. Sie erklären explizit Textinhalte. Manche Informationen werden nur durch Leichte Bilder wirklich verständlich. Das heißt, sie sind absolut notwendig, damit möglichst viele Leser*innen die Informationen aufnehmen können. Neben der visuellen Barrierefreiheit sollte deswegen für Leichte Bilder auch eine inhaltliche Barrierefreiheit erfüllt sein.
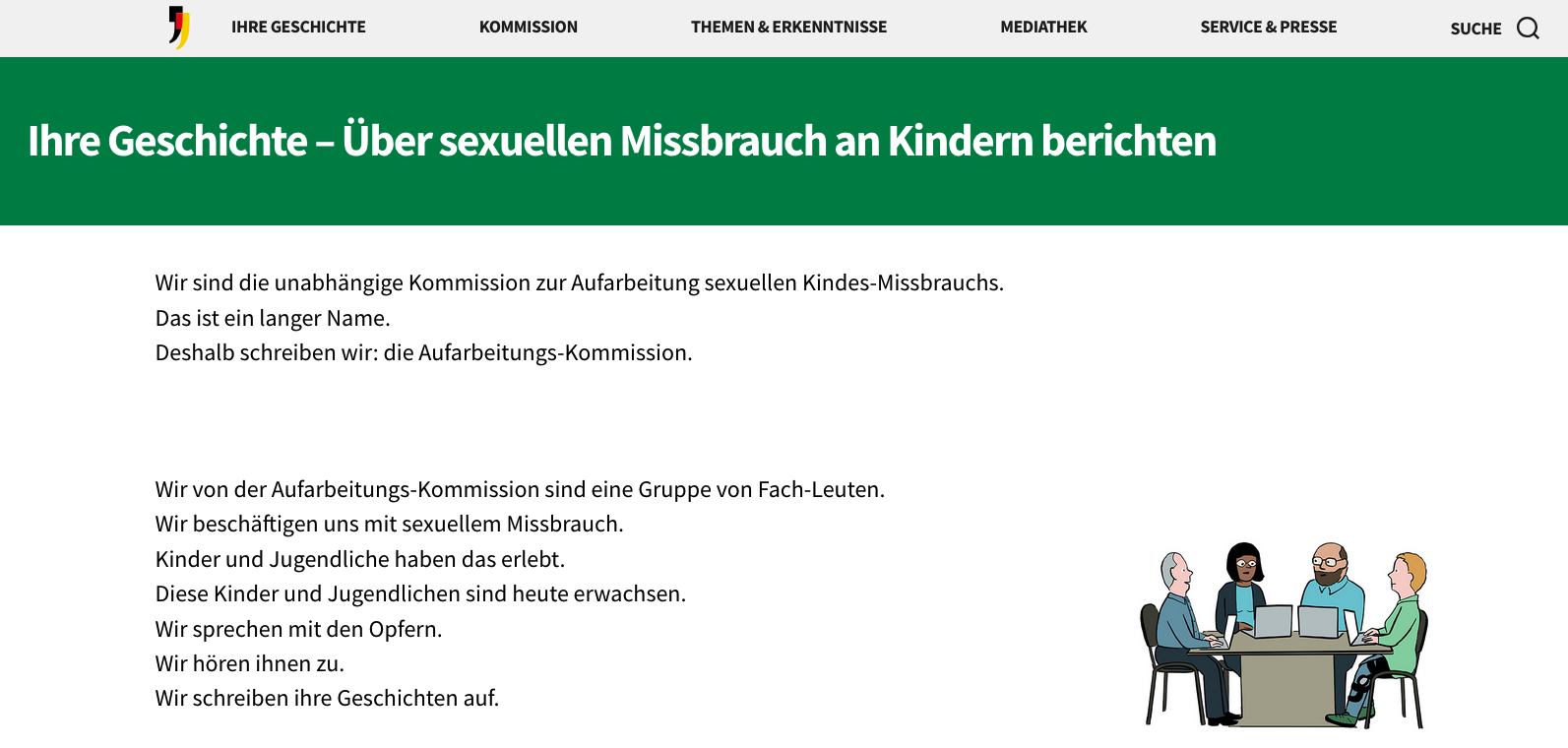
Dekorative Elemente einer Webseite unterstützen nicht die Nutzbarkeit einer Webseite oder App. In Bezug auf Barrierefreiheit sollte man darauf achten, dass sie nicht vom Hauptinhalt ablenken, sondern im Hintergrund bleiben.
Was bedeutet digitale Barrierefreiheit für Bilder?
Ohne Bilder und eine passende visuelle Gestaltung wären viele Webseiten und Apps zu unübersichtlich und einfach nicht benutzbar. Sie dienen uns allen, um uns besser auf einer Webseite zurecht zu finden, auf Informationen aufmerksam zu werden und Textinhalte besser zu verstehen.
Man sollte unterscheiden zwischen technischen Anforderungen und inhaltlichen Anforderungen an Bilder. Die technische Anforderungen sollen es den Nutzer*innen ermöglichen, den ersten Zugang zur Information zu bekommen. Die inhaltlichen Anforderungen sind dafür da, dass Inhalte korrekt eingeordnet und verstanden werden.
Technische Anforderungen
Alternativtexte für Bilder
Alternativtexte sind Bildbeschreibungen von Bildern. Blinde Menschen brauchen Alternativtexte zum Beispiel, damit Bildinformationen vorgelesen werden. So werden die Bilder überhaupt erst wahrnehmbar für blinde Menschen. Zum Lesen von Webseiten nutzen blinde Menschen einen Screenreader. Es gibt Inhalte, die interessanter werden und besser zu verstehen sind, wenn Bilder zusätzliche Informationen liefern. Deswegen sollten sie auch für blinde Menschen zugänglich sein. Alternativtexte sollten sachlich das Bild beschreiben ohne Interpretation. Dabei gilt: so viele Informationen wie nötig, aber so wenig wie möglich. Das, was relevant ist, um das Bild im Kontext zu verstehen und einzuordnen, wird in den Alternativtext geschrieben. Dabei werden Details weggelassen. Detaillierte Infos zu Alternativtexten findet man zum Beispiel auf der Seite von Domingos de Oliveira .
Gute Auffindbarkeit von Inhalten
Wenn Informationen auf einer Webseite leicht auffindbar sind, fühlen sich Leserinnen nicht überfordert und finden sich besser zurecht. Ein gutes Layout zeichnet sich dadurch aus, dass Nutzerinnen die Webseite oder die App intuitiv nutzen können.
Das heißt, Nutzer*innen sollten so wenig Zeit wie möglich mit Suchen verbringen, damit sie sich auf die Inhalte konzentrieren können. Die Bildmenge spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle. Zu viele Bilder können die Webseite schnell unübersichtlich machen, zu Reizüberflutung führen und ablenken. Sie sollte deswegen wohl bedacht sein.
Genug Kontrast
Um gut wahrnehmbar zu sein, müssen Bilder und Texte genug Kontrast aufweisen. So unterscheiden sie sich vom Hintergrund und sie werden nicht so leicht übersehen. Wenn z. B. Buttons, Warnhinweise oder Navigationselemente einen hohen Kontrast zum Hintergrund haben, sind sie leichter zu finden und zu bedienen – für Menschen mit dauerhaften Seheinschränkungen. Aber auch alle anderen Menschen, die kurzweilig eingeschränkt sind, profitieren von ausreichend Kontrast: zum Beispiel bei schwierigen Lichtverhältnissen (zum Beispiel draußen am Handy), wenn Nutzer*innen müde sind oder abgelenkt werden oder bei schlechten oder alten Ausgabegeräten. Für detaillierte Infos zum Thema Kontrast und Barrierefreiheit gibt es beispielsweise die Seite von leserlich.info.
Farben
Farben können die Aufnahme von Informationen unterstützen, aber sollten nie die einzige Art sein, Informationen zu zeigen. Gutes Design nutzt Farbe bewusst, aber immer ergänzend. Zum Beispiel wird ein Formularfeld rot, wenn etwas fehlt, aber es sollte zusätzlich auch Text zu dieser Information danebenstehen. Auch sollte es nicht zu viele Farben geben, weil sie die Sinne überreizen und vom Inhalt ablenken. Für Menschen mit einer Farbblindheit sollte man bestimmte Farb-Kombinationen vermeiden oder nur in bestimmten Mischungen mit anderen Farben zusammen einsetzen. Als Faustregel für gute Farben und Kontraste kann man sich merken, dass wichtige Inhalte auch in Graustufen verständlich sein sollten.
Schrift sollte gut lesbar sein
Bevor wir den Sinn in einem Text erfassen, müssen wir die Buchstaben und Wörter wahrnehmen und erkennen können. Ist die Schrift gut lesbar? Sind die Buchstaben groß genug? Kann man sie gut auf dem Hintergrund erkennen? Ist der Zeilenabstand angenehm? Textgestaltung ist sehr komplex und berücksichtigt immer mehrere Faktoren: Welche Lesegewohnheiten hat die Zielgruppe? Welches Ziel verfolgt der Text? Größen- und Abstandseinstellungen variieren je nach Schrift und Kontext.
Inhaltliche Anforderungen an Bilder
Freundlich, interessant und angemessen
Der erster Eindruck zählt und ist ausschlaggebend dafür, ob sich jemand mit einem Bild beschäftigt oder nicht. Ist das Bild interessant für mich? Was bedeutet das Bild? Damit sich die Betrachterin mit dem Bild beschäftigt, sollten Bilder vor allem freundlich und angemessen sein. So werden Türen geöffnet. Auch sollte das Bild der Zielgruppe und dem Zweck angemessen sein. Zu kindlich aussehende Bilder passen zum Beispiel weniger zu einer erwachsenen Zielgruppe.
Klarheit und Verständlichkeit
Dies ist ein sehr komplexes Gebiet aus dem Bereich „Barrierefreiheit von Bildern“. Denn ob ein Bild inhaltlich klar und verständlich ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Hier sollen ein paar Kernpunkte davon dargestellt werden.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich
Im Bildinhalt sollten Dinge dominieren, die zum Verständnis beitragen. Unnötiges sollte weggelassen werden oder im Hintergrund erscheinen. Das heißt rein dekorative Elemente sind in Leichten Bildern tabu. Bei vielen wichtigen Informationen sollte man sie auf mehrere kleinere Bilder verteilen, anstelle sie in ein einziges Bild zu stecken.
Grob verständlich
Bei Bildern gibt es die Schwierigkeit, dass sie von jedem Menschen unterschiedlich interpretiert werden. Das heißt, dass ein Bild per se nie eindeutig sein kann. Für bestimmte Inhalte braucht ein Bild einfach Text oder anderen Kontext als Ergänzung, damit der Inhalt eindeutig ist. Dies betrifft ganz besonders abstrakte Themen. Trotzdem kann derdie Gestalterin versuchen, mögliche grobe Missverständnisse im Vorfeld schon mitzudenken. Zum Beispiel indem eine klare Perspektive gewählt wird, in der die Situation gut erkennbar ist. Aufgrund dieser Vagheit muss ein Bild deswegen nicht hundertprozentig alleine verständlich sein. Es sollte aber eine eindeutige Richtung zum Inhalt vorgeben. Zum Beispiel sollte in einem Bild klar sein, ob die Stimmung in einem Bild gut oder schlecht.
Abstraktes vermeiden
Abstrakte Darstellungen sollten vermieden werden. Dazu gehören: Diagramme und hohe Zahlen, Metaphern, Witze und bestimmte Symbole. Alles, was ein „Um-die-Ecke-Denken“ verlangt, muss konkretisiert werden. Ein direkte Aussage ist immer besser und fassbarer. Konkretisieren ist zum Beispiel möglich, indem man ein Beispiel verwendet
Lebenswelt der Nutzer*innen berücksichtigen
Bilder sollten Motive aus der Lebenswelt der Nutzenden aufgreifen. Das heißt zum Beispiel: Welche Symbole und visuelle Sprache kennt die Zielgruppe? Bei komplexeren Bildern sollte das Bild eine bekannte Situation darstellen. Wenn jemand die Situation nicht nachvollziehen kann oder das Symbol nicht kennt, kann die Aufmerksamkeit der Nutzenden schnell abhanden kommen.
Universalität in Bildern
Universalität bedeutet, dass ein Bild von vielen Menschen verstanden werden kann, und dies möglichst unabhängig von Sprache, Alter, Bildung oder kulturellem Hintergrund. Bestimmte Symbole sind typisch nur für eine bestimmte Region. Farben werden zum Beispiel unterschiedlich interpretiert je nach Region. Auch Symbole, die kulturelle, gesellschaftliche und religiöse Besonderheiten darstellen, sind nicht für Außenstehende erkennbar. Wir brauchen kulturell neutrale Symbole.
Ein viel diskutiertes Thema ist die Frage nach Stereotypen. Zum Beispiel ist das klassische Toilettensymbol mit Männchen und Röckchen stereotypisch, wird aber überall auf der Welt verstanden. Symbole funktionieren aber nur mit Verallgemeinerung. So schaffen sie die Codes, die alle lesen können. Deswegen sind stereotypische Darstellungen in Symbolen meiner Meinung nach nicht zu vermeiden. Wichtig dabei ist, dass stereotypische Darstellungen mit nicht-stereotypischen Darstellungen gemischt werden sollten, um das Gesamtbild möglichst heterogen zu halten.
Fazit
Das BFSG ist mehr als ein rechtliches Muss – es ist auch eine Chance, Inklusion und Fairness im Unternehmen zu verankern und sich für eine weltoffene Welt nach außen zu präsentieren. Wer barrierefreie Bilder einsetzt, trägt aktiv dazu bei, Informationen für alle zugänglich zu machen. Das Gesetz ist auch eine Chance für Gestaltende, gutes Design mit barrierefreien Standards zu verbinden und es als neue Spielraum zu sehen. Denn gutes barrierefreies Design gibt es noch nicht genug in dieser Welt. Barrierefreiheit bedeutet zudem mehr Umsatz, da mehr Menschen erreicht werden. Das BFSG ist also ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
Habt Ihr Fragen oder braucht Leichte Bilder? Dann kontaktiert mich gerne per Mail oder Telefon!


https://u.to/k19LIg schrieb am 22. June 2025 um 14:06 Uhr
https://u.to/k19LIg